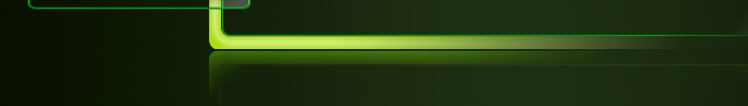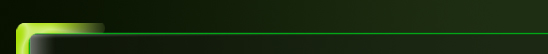
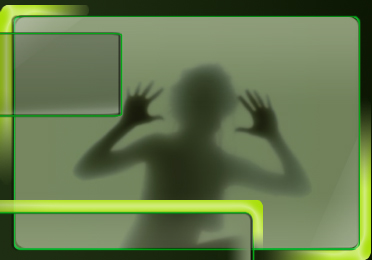

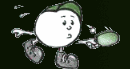

 |
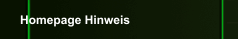 |
 |
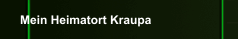 |
 |
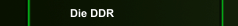 |
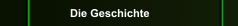 |
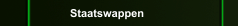 |
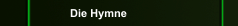 |
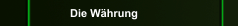 |
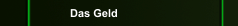 |
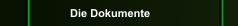 |
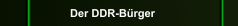 |
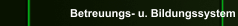 |
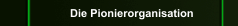 |
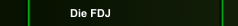 |
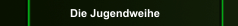 |
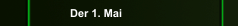 |
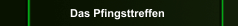 |
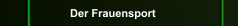 |
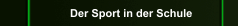 |
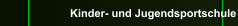 |
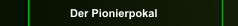 |
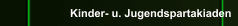 |
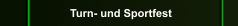 |
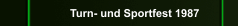 |
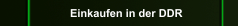 |
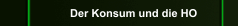 |
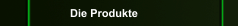 |
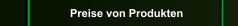 |
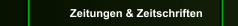 |
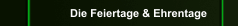 |
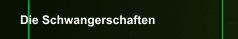 |
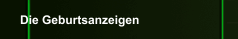 |
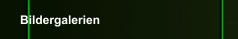 |
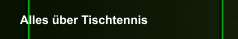 |
 |
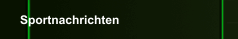 |
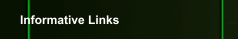 |
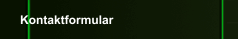 |
 |
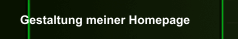 |
 |
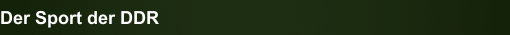
Das System im DDR-Sport
Das Betreiben von Sport genoss in der DDR einen sehr hohen Stellenwert, da es politische und gesellschaftliche Ziele der Regierung unterstrich. Vor allem der Erfolg in internationalen sportlichen Wettkämpfen war von großer Bedeutung, da er die für die DDR wichtige Außenpolitik unterstützte. Um diese hohen Ziele zu erreichen schuf die DDR nach dem Vorbild der UdSSR ein Kader-System, welches die spezielle Förderung jugendlicher Sporttalente als Grundlage hatte. Man bemerkte nämlich, daß vor allem während der Olympischen Spielen 1960 und 1964, immer jüngere Hochleistungssportler sehr erfolgreich an internationalen Wettbewerben teilnahmen. Spezielle Förderungsmaßnahmen wurden entwickelt, welche man in 3 Förderstufen eingeteilte: Die ersten Förderstufe setzte sich aus dem Bau von Trainingszentren und Trainingsstützpunkten zusammen. Erstere befanden sich in Bezirks- und Kreisstädten, letztere wurden in der Nähe von Dörfern und kleineren Gemeinden errichtet. Während in den Trainingszentren, aufgrund der hohen teilnehmenden Anzahl von Jugendlichen hauptsächlich Gruppen ausgebildet wurden, mußten sich die Trainingsstützpunke mit geringerer Anzahl von teilnehmenden Jugendlichen auf die Förderung Einzelner beschränken. Dies erwies sich jedoch als nicht rentabel, weswegen sie im Gegensatz zu den Trainingszentren nicht weiter ausgebaut wurden. Durch intensives Probe und Sichtungstraining wurden jugendliche Talente frühzeitig erkannt, gefördert und auf die Aufnahmeprüfung für Kinder- und Jugendsportschulen vorbereitet.
Die zweite Förderstufe bestand darin spezielle Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) einzurichten, welche neben allseitige Bildung und Erziehung der Schüler eine Vorbereitung auf hohe sportliche Leistungen boten. Um Unterricht und Training für die jeweiligen Schüler optimal zu koordinieren, richtete man Schulklassen ein, in welcher alle Schüler möglichst die gleiche Sportart betrieben. Die KJS zeichneten neben pädagogisch qualifizierten Direktoren und Lehrkräften auch die Ausbildung der Sportler durch erfahrene Trainer aus Sportclubs aus. Auch der Aufbau bzw. Ausbau spezieller Sportclubs war Teil der zweiten Förderstufe. Ihr Ziel war es, den jugendlichen Sportler mit einem nach neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebautes Training auf sportliche Spitzenleistungen vorzubereiten. Durch die gute Zusammenarbeit der Sportclubs mit den KJS konnte direkt auf individuelle Probleme der jungen Sportler, welche ihre schulische, sportliche, aber auch persönliche Entwicklung betrafen, eingegangen werden. Die dritte Förderstufe bildete die Auswahl einzelner Hochleitungssportler für die Nationalmannschaft der jeweiligen Sportart. Nach der schon so früh in Trainingszentren begonnenen Ausbildung und der professionellen Betreuung, waren diese jungen Erwachsenen optimal für ihre Aufgabe vorbereitet. Neben dem Fördersystem zeichnete sich der Sport in der DDR auch durch ein ganzjähriges Wettkampfsystem für Nachwuchssportler aus, zum Beispiel bei den Spartakiaden. Auf Kreis-, Bezirks- und DDR-Ebenen wurden sportliche Wettkämpfe ausgefochten, welche den Höhepunkt jedes Nachwuchssportlers bildeten. Zusammenfassend präsentiert sich der DDR-Leistungssport als dynamisch komplexes System. Die Komplexität zeigt sich vor allem im 3-stufigen Fördersystem mit seinen kooperierenden Organisationsformen. Dieses stabile Gerüst sorgt für leistungsfähigen und starken Nachwuchs für jede Art des Hochleistungssports, macht das System jedoch auch träge gegenüber Erneuerungen. Die Dynamik zeigt sich in der ständigen Weiterentwicklung der Trainingsmethoden aufgrund der Zusammenarbeit von Trainer und sportmedizinischen Wissenschaftlern, sowie der Einbindung gewonnener Erkenntnisse bei Auswertungen von sportlichen Leistungen im Trainingsprogramm.
Funktionen und Ziele des DDR-Leistungssports
Die DDR verfolgte mit der systematischen Förderung des Sportes verschiedene gesellschaftliche und politische Ziele. In sportlicher Hinsicht war die Olympiade das Hauptziel jedes professionelles Leistungssportlers. Erfolge bei diesem Wettstreit sollten weniger dem Sportler, sondern viel mehr der DDR dienen. Diese suchte internationale Anerkennung als eigener Staat zu bekommen und wollte zeigen, daß das System des Sozialismus dem Kapitalismus überlegen ist. Wichtig war dabei die BRD in den meisten Wettkämpfen zu schlagen. Aufgrund dieser außenpolitischen Bedeutung des Sportes wurden international antretende Sportler auch als Diplomaten im Trainingsanzug bezeichnet. In der Gesellschaft gab es weltweit in den 50er Jahren eine Aufwertung des Sports, welcher sich durch Entstehung neuer Sportarten und der Einführung des Frauensports äußerten. In der DDR wurde der Sport als Teil der sozialistische Körperkultur verstanden und sollte erzieherische Aufgaben erfüllen, sowie einen Beitrag zur kulturellen Lebensweise darstellen. Vor allem Jugendlichen sollte es ermöglicht werden, ihr Streben nach Erfolg, Anerkennung und höheren Leistungen zu verwirklichen. Sport als Freizeitbeschäftigung sollten Erkenntnisse über den menschlichen Körper liefern und zur allgemeinen Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit dienen. Man nahm an, daß sich sportliche Erfolge leistungsstimulierten auf wirtschaftliche, technologische und geistig-kulturelle Bereiche auswirken.
Folgen des DDR-Leistungssports
Leider war, neben dem System im DDR-Sport, auch das Doping ein wichtiger Grund, weswegen die DDR in sportlicher Hinsicht erfolgreicher war als andere Staaten. Circa 10.000 Sportler wurden zwischen 1970 und 1989 in der DDR mit Anabolika gedopt. Bis Ende 2005 wurden 194 Sportlerinnen und Sportler nach dem Doping-Opfer-Hilfe-Gesetz als Dopingopfer anerkannt. Dies läßt sich an den Schicksalen von Karen König, von Birgit Pabst und von Birgit Uibel exemplarisch für viele andere Dopingopfer zeigen:
Karen König war zehn Jahre alt, als sie zu den drei besten Schwimmerinnen des Trainingszentrums in Berlin-Friedrichshain zählte. Sie wurde zum TSC Berlin delegiert, in die fünfte Klasse der Kinder- und Jugendsportschule Ernst Grube auf dem Prenzlauer Berg. Zu dem Zeitpunkt für das Mädchen die Erfüllung eines Traums. In der Kaderschmiede begann der Tag morgens um sechs und endete abends um acht. Dazwischen mußte Karen König für die Schule pauken, zwei- oder dreimal durchs Wasser pflügen und ihren Körper beim "Landtraining" im Kraftraum stählen. "Die Kindheit und der Spaß waren schnell vorbei." Schon in der sechsten Klasse begann die Medikamentenausgabe. Ihr Schwimmtrainer versorgte sie nach den Übungseinheiten mit Dynvital, einer Art Brausepulver und angeblich ein Vitamin-Mineral-Gemisch. Der Trainer saß am Beckenrand an einem weißen Tisch, und auf dem Tisch stand ein Becher mit ihrem Namen drauf. Karen König mußte das Gebräu unter Aufsicht herunterwürgen. Dann stand da noch eine kleine braune Glasflasche, darin befanden sich orangefarbene und weiße Tabletten. Zusammen fünf oder sechs Stück. Die mußte sie auch noch schlucken.Wann genau ihr das erste Mal Oral-Turinabol verordnet wurde, weiß Karen König nicht mehr. Sie sagt, sie müsse 14 oder 15 Jahre alt gewesen sein. Sie erhielt die hellblauen Pillen, Durchmesser fünf Millimeter, meist in dreiwöchigen Zyklen vor internationalen Wettkämpfen. Die Größe der Ration schwankte. Mal erhielt sie eine Fünfmilligrammtablette pro Tag, oft zwei. Vor einem Jugendwettkampf im Januar 1985 betrug die Dosis 10 bis 15 Milligramm. Kristin Otto, die heutige ZDF-Reporterin, die 1988 in Seoul sechs olympische Goldmedaillen gewann, schwamm mit Karen König in der Staffel. Bis Ende 1986, präziser lässt sich das nicht sagen, wurde Karen König mit der Droge gefüttert, ohne zu ahnen, was sie sich in den Mund steckte. Ihr Erweckungserlebnis hatte sie 1990, drei Jahre nach dem Ende ihrer Laufbahn. Sie traf sich mit ein paar Mitgliedern der alten Schwimmgruppe im Nikolaiviertel zum Kaffee bei Klaus Klemenz, ihrem ehemaligen Trainer. Es war eine fröhliche Runde. Irgendwann sprachen sie zufällig über Doping und alberten, Karen König könne doch wieder anfangen zu trainieren. Klemenz sagte: "Dann kommst du zu mir, und wir zeigen es allen noch einmal." Er habe auch noch "ein paar von den Blauen im Schrank". "Wie wäre mein Leben ohne Doping verlaufen?" Eine Antwort suchte sie im Mai 2000 beim Strafverfahren gegen die Drahtzieher des systematischen DDR-Kinderdopings: Manfred Ewald (von 1961 bis 1988 Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR) und Manfred Höppner (von 1975 bis 1990 Leiter der "Arbeitsgruppe Unterstützende Mittel"). Karen König saß als Nebenklägerin im Saal. Als erstes Opfer des DDR-Zwangsdopings hat sie Klage erhoben gegen das Nationale Olympische Komitee. Vom NOK fordert sie 10.225 Euro Schmerzensgeld wegen Körperverletzung. Karen König wurde ausgezeichnet mit dem Vaterländischen Verdienstorden der DDR in Gold und belohnt mit einer Schiffsreise nach Kuba. Aus Sicht der Partei erfüllte sie damals ihr Soll. Heute ist Karen König eine kranke Frau. Die Literaturwissenschaftlerin leidet an immer wiederkehrenden Depressionen und einer tiefen männlichen Stimme.
Birgit Pabst wurde 1974 an einer KJS aufgenommen, da man sie aufgrund ihrer Größe und ihrer schlanken Figur von 1,70m geeignet hielt, Kugelstoßerin zu werden. Unwissend nahm sie die von ihrer Trainerin verabreichten Pillen ein, welche sich im nachhinein als Doping-Mittel herausstellten. Nach sportlichen Erfolgen, wie dem Gewinn einer Spartakiade und der Teilnahme an einer Pioniersport-Olympiade, verletzte sie sich während eines Trainingslageraufenthaltes am Fuß. Die Diagnose war ein Bänderriss und Absplitterungen am Knöchel, das Aus für ihre sportliche Karriere. Nach Beendung einer Schneiderlehre, heiratete sie Anfang 20. Weil sie nicht schwanger wurde, verschrieb ihr Arzt ihr eine Hormonbehandlung. Dies hatte zur Folge, daß sie durch eine Wechselwirkung zwischen Anabolika und Hormonpräparaten in einem Jahr um 30 Kilo zunahm. Das Kind, welches sie später gebar, leidet an Asthma und Neurodermitis. Auch sie ist nicht verschont geblieben. Aus dem einstmals schlanken jungen Mädchen, ist eine dicke Dame geworden, welche an Bluthochdruck, Diabetes, allerlei Allergien und auch Asthma leidet und mit männlichem Haarwuchs zu kämpfen hat. Die durch das Doping gestärkten Rückenmuskeln ließen sich Gewichte zumuten, welche ihrer Wirbelsäule nicht gewachsen waren. Die Folge war ein kaputter Rücken. Birgit Pabst geht es wie vielen anderen Hochleistungssportlern in der DDR. Vor allem die Sportlerinnen leiden unter der Doping-Behandlung. Wenn sie überhaupt noch schwanger geworden sind, sind Ihre Kinder oft chronisch krank oder auch behindert. Ausgleichszahlungen seitens der Regierung erfolgen nur spärlich: 1000 € pro Person sind das Maximum, da es zu viele Geschädigte gibt. Und das obwohl die jährlichen Arztkosten ca. 5000 € betragen. Die einstigen gefeierten Erfolge des Sozialismus fordern naturgemäß ihren Preis, jedoch ist dieser angesichts der katastrophalen Folgen kaum tragbar.
Birgit Uibel - Rätselhafter Tod mit 48 Jahren
Vor einer Woche (am 10. Januar 2010) ist die ehemalige DDR-Hürdenläuferin vom SC Cottbus, Birgit Uibel, verstorben. Der Tod kam im frühen Alter von 48 Jahren, als Todesursache wurde eine innere Erkrankung genannt. Konkrete Angaben darüber hinaus gibt es nicht. Birgit Uibel, geborene Sonntag, war staatlich anerkanntes Dopingopfer und sie war ab dem Alter von 15 Jahren mit männlichen Steroiden vollgepumpt worden. Birgit Uibel befand sich anfangs der 80er-Jahre auf ihrem leistungssportlichen Höhepunkt. Da wurde sie zehn Mal bei Länderkämpfen in die DDR-Auswahl berufen. Bei den Europameisterschaften 1982 in Athen belegte sie den sechsten Platz im 400-Meter-Hürden-Lauf. 1984, im Jahr des Los Angeles-Olympia-Boykotts der DDR, gewann Birgit Uibel als 22-Jährige den DDR-Meistertitel über 400 Meter Hürden in 54,90 Sekunden, danach beendete sie ihre Leistungssport-Karriere und brachte 1985 ihre Tochter auf die Welt. Von 1981 bis 1990 war sie mit dem heutigen Radsport-Bundestrainer Detlef Uibel verheiratet. Birgit Uibel war ein vom Bundesverwaltungsamt Köln staatlich anerkanntes DDR-Doping-Opfer. Im Jahr 1997 hatte die Ex-Athletin mit ihren präzisen Aussagen, die sie auch öffentlich vertrat, bei der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung des Staats-Dopings in der DDR geliefert. Ihre Schäden an Leber- und Schilddrüse waren erheblich, dazu die schwere Rücken-Akne, die taubeneigroßen Geschwülste im Oberschenkel und dann die schwere Körper-Behinderung ihrer Tochter. All dies führte sie auf die Einnahme von hohen Dosierungen an vermännlichenden Sexualhormonen zurück, die von ihrem Club-Arzt Bodo Krocker sowie ihrem Trainer Siegfried Elle angeordnet und vergeben worden waren. In erster Linie wurde sie mit Oral-Turinabol gedopt. Gegen beide, Krocker und Elle, sowie gegen die Haupt-Verantwortlichen im Deutschen Turn- und Sport-Bund der DDR, Manfred Ewald und Manfred Höppner, stellte Birgit Uibel Strafantrag.
Dem Deutschlandfunk liegt das Protokoll der ZERV aus der Anhörung der Zeugin Uibel aus dem Jahr 1997 vor. Darin heißt es unter anderem: "Bezüglich der ärztlichen Betreuung kann ich für meine Person den Arzt Bodo Krocker, er praktiziert heute noch in Cottbus, angeben. Bei Tests und in Trainingslagern und bei Wettkämpfen waren die Ärzte Dr. Hans-Joachim Wendler und Dr. Manfred Höppner zugegen. Alle 14 Tage mußte ich Blut und Urin abgeben. Dieses erfolgte in der Sportmedizin Cottbus mit eigenem Labor. Der Arzt Krocker war dort auch Chef. Diese regelmäßigen Kontrollen wurden bei mir ab 1979 - ich war 16 Jahre alt - durchgeführt. Dieses war auch der Zeitpunkt, wo ich erstmals unterstützende Mittel erhalten habe. Mein Trainer Siegfried Elle sagte mir, daß ich wegen eines Gespräches zum Arzt Krocker gehen müsse. Ich wurde allein dort vorstellig. Dr. Krocker versuchte mir zu erklären, warum ich diese unterstützenden Mittel nehmen müsse. Ich würde durch diese Einnahme der Mittel bessere Leistungen erzielen und dadurch an großen Wettkämpfen teilnehmen können. Er machte sinngemäß auch Versprechungen, die mir einen Vorteil dahin gehend verschaffen würden, daß ich Reisekader für das kapitalistische Ausland sein könnte und ähnliches mehr. Als 16-jähriges Mädchen vertraute ich ihm bedingungslos. Ich stellte keine Fragen, weil ich ja auch innerlich bereit war, sportliche Erfolge für mich und mein Land zu erzielen. Der Arzt Krocker übergab mir dann an diesem Tag einen Briefumschlag mit kleinen blauen Pillen. Ein Medikamentenname war nicht zu erkennen. Diese Pillen sollte ich morgens einnehmen und abends dann die Anti-Baby-Pille. Mit der Anti-Baby-Pille sollte auch eine vorzeitige Schwangerschaft verhindert werden. Gleichzeitig forderte mich der Arzt Krocker zur strengsten Verschwiegenheit darüber auf. Ich sollte mit niemanden über die Einnahme dieser blauen Pille reden. Ich habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht, weil ich den Erfolg unbedingt wollte. Ich dachte vielmehr an eine Vitaminsubstanz. Über negative Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus der Einnahme dieses Mittels ergeben könnten, hat er nicht gesprochen. Gesagt hat Dr. Krocker auch, daß ich diese Pillen immer heimlich, niemand sollte es sehen, einnehmen sollte." Soviel aus dem ZERV-Protokoll von Birgit Uibel.
In einem Interview mit ihrer Heimatzeitung "Lausitzer Rundschau" im Jahr 2003 hatte sie rückblickend gesagt: "Wenn ich damals gewußt hätte, was das Zeug anrichten kann, hätte ich es nicht genommen. Wer sich geweigert hat, mußte aufhören."
Selbst über den frühen Tod hinaus gibt es bei den einstigen Tätern und Mitwissern des DDR-Dopings keine veränderte Haltung. Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärte jetzt ihr Trainer Siegfried Elle, er fühle sich nicht schuldig. Wenn Frau Uibel damals Dopingmittel bekommen habe, dann hätte sie selbst davon gewußt. Er jedenfalls habe ihr kein Doping verabreicht, behauptet Elle. Der Todesfall Uibel wird obendrein erneut die Frage aufwerfen, wie man mit dopinggeschädigten Kindern umgeht. Der Heidelberger Krebsforscher Werner Franke fordert einen "vielleicht wichtigsten letzten Dienst", den man Birgit Uibel und dem Sport erweisen könne, und zwar eine dem internationalen Standard entsprechende pathologische Untersuchung ihrer Schäden.
Quelle: Deutschlandfunk / Deutschlandradio vom 17.01.2010 von Thomas Purschke
Der Sport in der DDR wurde vom SED-beherrschten Staat offiziell intensiv gefördert. Vor allem die Sportclubs konzentrierten sich auf die olympischen Sportarten und diese waren im Fokus der Sportförderung. Die DDR sollte durch Spitzenergebnisse im Leistungssport an internationalem Ansehen gewinnen. Es gab zahlreiche Sportvereine und Sportgruppen, in denen die Mitgliedschaft nahezu kostenlos war, zum Beispiel bei den Betriebssportgemeinschaften (BSG) und bei den Schulsportgemeinschaften (SSG). Daneben gab es Motorsportgemeinschaften und Motorsportclubs im ADMV, Wehrsportgruppen der GST und zahlreiche eigens der Leistungssportförderung gewidmete Kinder- und Jugendsportschulen, sowie eine Hochschule, die Deutsche Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig.
Internationale Meisterschaften
203 Olympia-Goldmedaillen gingen an die DDR, insgesamt 755 Olympiamedaillen. 768 Weltmeister und 747 Europameister sind DDR-Sportler.
Von 1952 bis 1964 nahmen DDR-Sportler im Rahmen einer gesamtdeutschen Mannschaft an den Olympischen Spielen teil. Von 1968 bis 1988 gab es eine eigene Mannschaft der DDR.
Sport in der DDR - (Körper) Erziehung im Dienste der SED
Die Kehrseite der Medaille
Sport in der DDR. Glanzvolle Turnfeste, ein breites Angebot im Freizeitsport, zahlreiche Olympiasiege, daß war die Schauseite der Medaille. Die Kehrseite war ideologische Überfrachtung, Militarisierung und staatliche Dopingprogramme.
Sport sollten die Bürger in der DDR nicht nur im Dienst ihrer eigenen Gesundheit, sondern immer auch im Dienst der SED treiben: Wenn Kinder sich im Schulsport auf ihre Aufgaben bei der Landesverteidigung vorbereiteten, wenn auf der Osttribüne des Leipziger Zentralstadions die Losung "Dank dir Partei" erschien oder wenn tausende MfS-Mitarbeiter zur Absicherung der Turn- und Sportfeste abrückten, dann ging es vor allem um zwei Dinge: Ein ganzes Volk in ständiger Wehrbereitschaft zu halten und durch sportliche Höchstleistungen die Überlegenheit des sozialistischen Systems zu demonstrieren. Die Werkausstellung des Bürgerkomitee Leipzig e.V. setzt sich kritisch mit der Bedeutung des Sports in der DDR als einem Instrument zur (Körper) Erziehung im Sinne der Diktatur auseinander. Sie dokumentiert, wie die SED den Massen- und Leistungssport in staatlich gelenkte Strukturen presste, um ihn in ihrem Sinne zu nutzen. Sie zeigt, welche politische Rolle der Sport spielte und welche Ziele die SED mit seiner Förderung verband.
Fazit:
Der Sport wurde noch nie von einem Staat so stark gefördert und noch nie diente
dieser so ausgeprägt als Stütze eines Regimes, wie dies in der DDR der Fall war. Der Sport spielte in der DDR eine große Rolle. Von klein an wurden die Menschen
angeregt, Sport zu treiben. Bis ins hohe Alter gab es die Möglichkeiten zur
sportlichen Betätigung.
Internetpräsenz seit März 2007
 |